
Nürnberg und die Reichskleinodien
| Beitrag vom 24. Juni 2020, von Andreas Krätzer
Das Heilig-Geist-Spital war im Mittelalter und der Frühen Neuzeit nicht allein Stätte der Krankenpflege und des religiösen Lebens, sondern gewann auch weit über die Stadt hinaus politische Bedeutung: Dreieinhalb Jahrhunderte (1424–1796), diente das Spital als Aufbewahrungsort der Reichskleinodien und damit des wichtigsten Schatzes des Heiligen Römischen Reichs.
Die Reichskleinodien wurden im Mittelalter und bis weit in die Neuzeit hinein als weltliche, symbolische Herrschaftsinsignien betrachtet. Sie hatten vor allem eine enorme symbolische Bedeutung: Die Vormoderne war eine Zeit, in der viele Menschen nicht Lesen und Schreiben konnten, weshalb noch mehr als heute auf symbolische Kommunikation gesetzt wurde. In der mittelalterlichen Auffassung konnte nur derjenige nach der Wahl zum Herrscher werden, der am richtigen Ort mit den richtigen Herrschaftszeichen gekrönt wurde. Für die Menschen waren also die Reichskleinodien die Verdinglichung des Reiches.
Die 31 Stücke der Reichskleinodien teilen sich auf in die Nürnberger (28 Teile) und die Aachener (3 Teile) Kleinodien und stellen den einzigen mittelalterlichen Kronschatz dar, der bis heute nahezu unverändert erhalten ist. Diese bestanden aus den Krönungsinsignien der Kaiser und Könige des Heiligen Römischen Reiches (Schwert Karls des Großen, Kaiserkrone Ottos des Großen, Zepter, Reichsapfel, Krönungsgürtel...) und verschiedenen Reliquien (Rock Johannes’ des Evangelisten, Zahn Johannes’ des Täufers, ein Stück der Krippe von Bethlehem, ein Span vom Kreuz Christi und die heilige Lanze).
Die Nürnberger Kleinodien verdanken ihren Namen der Tatsache, dass sie von 1424 bis 1796 in der Kapelle des Nürnberger Heilig-Geist-Spitals aufbewahrt wurden. Nach diversen Aufenthaltsorten entschied sich König Sigmund 1424, die Reichskleinodien für „ewige Zeit“ in Nürnberg zu verwahren.
Die Reichskleinodien fanden ihren Platz in zwei voneinander getrennten Verwahrorten im Heilig-Geist Spital: Die Reichsinsignien (Krone, Reichsapfel, Schwerter etc.) und der Reichsornat (Krönungsmantel, etc.) wurden in einem Gewölbe oberhalb der Sakristei der Kirche in einem Wandschrank deponiert. Die Reichsreliquien wurden im so genannten Heiltumsschrein verwahrt, welcher unter dem Chorgewölbe herabhing. Man wollte den Gläubigen die Präsenz der Reliquien nahe am Altar zeigen – somit waren sie für alle sichtbar und zugleich sicher vor Diebstahl.
Von 1424 bis 1524 wurden die Reichskleinodien und Reichsreliquien einmal im Jahr, am zweiten Freitag nach Ostern zum Fest der Hl. Lanze, auf dem Hauptmarkt dem Volk präsentiert. Für die so genannten Heiltumsweisungen wurde gegenüber der Frauenkirche vor dem Schopperschen Haus (wurde im Krieg zerstört / Hauptmarkt 15) der Heiltumsstuhl aufgebaut. Dies war eine etwa sieben Meter hohe und dreigeschossige hölzerne Konstruktion, von der die Heiltümer „gewiesen“ wurden. An dieses „Event“ schloss sich eine florierende 14-tägige Handelsmesse an. Hier konnten unter anderem Erinnerungsstückegekauft werden. Das waren Pilgerzeichen, Heiltumsbüchlein oder Holzschnitte mit den Abbildungen einzelner Heiltümer. Seitdem die Reichsstadt Nürnberg im Jahre 1525 der Lehre Luthers anhing, betrachtete man die Reliquienverehrung als Abgötterei. Daher wurden die Heiltumsweisungen eingestellt. Die Handelsmesse blieb in der Form des Ostermarktes bis in die heutige Zeit erhalten. Somit ist der Ostermarkt der älteste Markt in Nürnberg.
Erst im 18. Jahrhundert verließen die Reichskleinodien Nürnberg. Aus Furcht vor den herannahenden französischen Revolutionstruppen brachte man den Schatz zuerst nach Regensburg und später nach Wien, wo er bis heute ist. Von der langen Aufbewahrungsdauer des Kronschatzes in Nürnberg leiteten viele Nürnberger*innen ein gewohnheitsmäßiges Eigentumsrecht der Stadt Nürnberg an den Reichskleinodien ab. Dies zeigt sich zum einen an der Tatsache, dass viele – auch prominente – Nürnberger*innen im 19. Jahrhundert immer wieder eine Rückgabe der Reichskleinodien forderten und zum anderen an dem Beinamen „Des Deutschen Reiches Schatzkästlein“, der sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts für Nürnberg entwickelte.
Diesen Mythos wollten sich auch die Nationalsozialisten zu Nutze machen. Der nationalsozialistische Oberbürgermeister Willy Liebel wollte die Reichskleinodien zurück nach Nürnberg holen und betrachtete dies gar als eine seiner wichtigsten Aufgaben. So kamen die Reichskleinodien zwischen 1938 und 1946 noch einmal zurück nach Nürnberg.
Heute erinnert an die Zeit der Verwahrung der Reichskleinodien in der Spitalkirche, neben dem originalen Heiltumsschrein im Germanischen Nationalmuseum und den Nachbildungen von Krone, Szepter und Reichapfel – aufbewahrt zuerst im Rathaus und heute im Stadtmuseum im Fembo-Haus – die von Reinhard Eiber modellierte Bronzetafel an der westlichen Außenwand der ehemaligen Kirche.


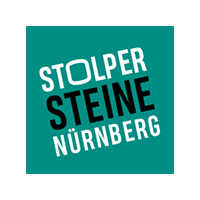
Kommentare
Keine Kommentare