Oder die vergessene Rache jüdischer Holocaust-Überlebender
| Beitrag vom 9. Juli 2025
Zugegeben, ich war nicht wenig erstaunt, als ich zum ersten Mal von Abba Kovner (1918–1987) und der Gruppe „Nakam“ hörte. Jüdische Rache für den Holocaust? Eine geheime Mission in Nürnberg, die Tausende von Opfern fordern sollte? Das war mir neu. Mein Blick auf die Geschichte der europäischen Jüdinnen und Juden um 1945 war vor allem von der Perspektive ihres unglaublichen Leids und ihrer Ohnmacht angesichts des größten Menschheitsverbrechens der Geschichte geprägt. Umso neugieriger machte ich mich an die Lektüre: Die israelische Historikerin Dina Porat hat mit ihrem Buch „Die Rache ist Mein allein“ (2021) Licht in dieses weitgehend unbekannte Kapitel der Nachkriegsgeschichte gebracht. Es ist die Geschichte von Nakam – hebräisch für „Rache“ –, einer Geheimorganisation jüdischer Holocaust-Überlebender, die 1945/46 einen beispiellosen Rachefeldzug plante.
Die Organisation Nakam
Nakam bestand aus rund 50 jungen jüdischen Frauen und Männern, die den Holocaust überlebt hatten. Die meisten waren als Partisaninnen und Partisanen aktiv am Widerstand gegen die nationalsozialistische Besatzung in Osteuropa, vor allem in Litauen, beteiligt gewesen und hatten sich im Frühjahr 1945 zu einer festen Gruppe zusammengeschlossen. Ihr Anführer war Abba Kovner, ein charismatischer Intellektueller, der seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit der Idee einer selbstbestimmten Vergeltung mobilisierte: Das kollektive Trauma des Holocausts sollte nicht bloß erinnert werden, die Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden nicht folgenlos bleiben. Kovner wollte vielmehr handeln, um eine subjektiv empfundene Gerechtigkeit herzustellen.
Plan A: Vergeltung im großen Stil
Der erste Plan – intern „Plan A“ genannt – war so kühn wie erschütternd: In mehreren deutschen Großstädten sollte im Laufe des Jahres 1945 das Trinkwasser vergiftet werden. Für sechs Millionen jüdische Opfer sollten sechs Millionen Deutsche sterben. Mitglieder der Gruppe schleusten sich in Wasserwerke ein, logistische Details wurden minutiös geplant. Doch der Plan scheiterte: Nach dem offiziellen Kriegsende im Mai 1945 füllten sich die Städte schnell mit Alliierten, Holocaust-Überlebenden und Displaced Persons. Die Unterstützung für eine Massenvergeltung begann zu bröckeln, auch innerhalb der Gruppe. In Israel befürchtete man zudem, dass ein solches Massaker die Gründung eines jüdischen Staates unmöglich machen würde. Letztlich beendete die Planungen aber ein Zufall: Kovner, der in Palästina das Gift besorgt hatte, wurde im Dezember 1945 auf dem Weg nach Europa festgenommen. Plan A war gescheitert, bevor er überhaupt begonnen hatte.
Plan B: Das vergiftete Brot von Nürnberg
Doch Nakam gab nicht auf. Es folgte „Plan B“ – gezielter, kleiner, aber nicht weniger drastisch. Im Visier stand ein Kriegsgefangenenlager im heutigen Nürnberger Stadtteil Langwasser, wo ab 1945 über 10.000 ehemalige SS-Soldaten interniert waren. Die „Konsumgenossenschaft Nürnberg-Fürth“ belieferte das Lager mit Brot aus ihrer Großbäckerei im Schleifweg 37. Am Abend des 13. April 1946 versteckten sich drei Nakam-Mitglieder nach Dienstschluss in der Bäckerei und bestrichen rund 3.000 Laibe Brot mit einer Mischung aus Arsen und Kleber. Das Gift war in Paris von einem verbündeten Chemiker hergestellt und über Umwege nach Nürnberg transportiert worden. Doch auch dieser Plan scheiterte: Obwohl das Brot am nächsten Tag tatsächlich ausgeliefert wurde und rund 2.200 Insassen über Vergiftungssymptome klagten, starb niemand. Das Gift war vermutlich zu dünn aufgetragen worden.
Ein einmaliger Racheakt und sein Nachhall
Die Geschichte von Nakam ist spektakulär. Um 1945 gab es zwar vereinzelt Personen und militärische Einheiten, die sich die Tötung ehemaliger Nationalsozialisten auf die Fahnen geschrieben hatten, aber keinen so systematisch geplanten Rachefeldzug wie diesen. Die Öffentlichkeit erfuhr erst Jahrzehnte später davon, als ehemalige Mitglieder in den 1980er Jahren über ihre damaligen Pläne zu sprechen begannen. Der Giftanschlag in Nürnberg hatte sich schließlich nie nachweisen lassen, eine jüdische Beteiligung war von den ermittelnden Behörden nicht einmal in Betracht gezogen worden und die Gruppe hatte sich nach ihrer Flucht aufgelöst. Auch Jahrzehnte nach der Tat war die Erinnerung einiger Nakam-Mitglieder von Bedauern über das Scheitern ihrer Pläne geprägt.
Die Geschichte von Nakam wirft eine unbequeme Frage auf: Was geschieht, wenn sich Opfer zu Richtern machen? Dina Porats Buch bietet eine Möglichkeit, sich mit diesem wenig bekannten Aspekt der Nachkriegsgeschichte auseinanderzusetzen und gibt auf der Grundlage zahlreicher Gespräche einen Einblick in die Gefühlswelten der Beteiligten. Wer lieber auf Unterhaltung setzt, kann sich außerdem den deutsch-israelischen Spielfilm „Plan A – Was würdest du tun?“ ansehen, für den wir im Mai mit dem Bayerischen Rundfunk einen kleinen Teaser gedreht haben.
Bild: Nach dem Giftanschlag untersuchten US-Soldaten und Kriminalbeamte die Räumlichkeiten der Genossenschaftsbäckerei im Schleifweg 37 in Nürnberg (US National Archives and Records Administration, Public Domain).



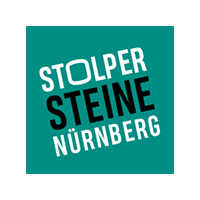
Kommentare
Keine Kommentare