
Die Fleischbrücke als wandelbarer "Star" im Stadtrundgang
| Beitrag vom 16. März 2021, von Lena Prechsl
Während wir im Corona-Lockdown sehnlich auf sinkende Fallzahlen und damit auch auf eine Perspektive für den Neustart unserer Stadtführungen warten, beschäftigen wir uns selbstverständlich viel mit der Neukonzeption und Überarbeitung unserer Bildungsprogramme. Dabei freuen wir uns immer wieder, mit welch faszinierenden historischen Bauwerken wir uns in unserer täglichen Arbeit beschäftigen dürfen. Eines davon ist die Nürnberger Fleischbrücke, die in so vielen unserer Stadtrundgänge in der Altstadt besprochen wird. Etliche stadtgeschichtliche Aspekte werden an der Brücke deutlich: So steht sie als Bauwerk an sich für das hohe technische Verständnis, das bereits Ende des 16. Jahrhunderts den Ratsbaumeister Wolf-Jacob Stromer in Zusammenarbeit mit den Zimmermeistern Mathes Herdegen und Peter Carl und Baumeister Jacob Wolff d.Ä. im Brückenbau anwendete. Dann lässt sich die im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit so wichtige Handelsverbindung nach Italien illustrieren, ist doch die Fleischbrücke der venezianischen Rialtobrücke nachempfunden. Und wenn eine italienisch anmutende Brücke ihren Platz mitten in einer fränkischen Reichsstadt findet, so zeigt sich, dass nicht nur Güter von Italien nach Nürnberg kamen. Es fand vielmehr auch ein bedeutender Kulturtransfer statt. Die vielen italienischen Einflüsse werden über die Brücke hinaus ja auch an den zahlreichen humanistischen Werken, die in Nürnberg entstanden sind, deutlich.
Doch nicht nur kunst- und kulturhistorisch ist die Brücke interessant. Bei unseren Stadtführungen dient sie auch mit dem an sie anschließenden Ochsenportal als Aufhänger für den Fleischkonsum im Wandel der Zeit. So sind Fleischbrücke und das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Fleischhaus wichtige Stationen unseres ernährungsgeschichtlichen Rundgangs „Rotes Bier und blaue Zipfel“. Die Brücke musste sogar darauf ausgelegt werden, dass ganze aus dem Osten importierte Ochsenherden, die im Fleischhaus geschlachtet werden sollten, das Bauwerk passieren konnten.
Auch rechts- und kriminalgeschichtlich ist die Brücke ein spannender Ort. Auf dem Vorgängerbau der heutigen, 1598 fertiggestellten Brücke befand sich der sogenannte Ohrenstock, in dem der Henker seine Instrumente zur Durchführung von körperlichen Strafen aufbewahrte. Und auch als Ort der Bestrafung „am Leib“ findet die Fleischbrücke ihren Platz in der Nürnberger Kriminalgeschichte und damit auch in unserer Stadtführung „Mörder, Fälscher, Messerstecher“. So wurde hier zum Beispiel einem Mann, der wegen Gotteslästerei verurteilt worden war, von Nürnbergs bekanntestem Henker Franz Schmidt 1591 die Zunge abgeschnitten.
In unserem Rundgang „Romantische Pegnitz?!“ erklären wir am Beispiel der Fleischbrücke hingegen, dass das Fragezeichen im Rundgangstitel völlig zurecht steht. Denn der heute so bekannte, steinerne Bau ist überhaupt erst entstanden, weil ein gewaltiges Hochwasser die hölzerne Vorgängerbrücke 1595 vernichtete. Damit findet die Fleischbrücke auch im Themenkomplex der Umweltgeschichte ihren Weg in unsere Bildungsarbeit.
Anhand der vielen historischen Dimensionen und Zusammenhänge, die an einem einzigen Bauwerk erläutert werden können, zeigt sich, wie faszinierend die Arbeit mit der Stadtgeschichte ist und wie viel es im öffentlichen Raum zu entdecken gibt. Es lohnt sich also immer, ob auf einem Stadtrundgang oder alleine, die Augen offen zu halten. Es gibt viel zu entdecken.



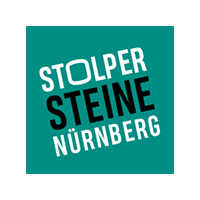
Kommentare
Keine Kommentare